Kaum Schlagzeilen, kaum Aufmerksamkeit, aber maßgeblich für unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren. Denn die Regierung hat nichts gelernt. Nach wie vor framen sie Migration als Wurzel allen Übels – und das komplett entgegen der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Der jüngste Beweis: Das Bundesministerium des Innern unter Leitung von Alexander Dobrindt (CSU) hat ein Gesetz eingebracht, das die erst kürzlich eingeführte Möglichkeit der Einbürgerung unter besonderen Umständen nach drei Jahren („Turboeinbürgerung“) wieder abschafft. Mit den Stimmen der Regierungskoalition und der AfD wurde dieses Gesetz am 8. Oktober 2025 im Bundestag verabschiedet.
Dass die CDU/CSU damit wissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht, stand nicht auf der Agenda im Bundestag: Diese Maßnahme würde laut Politikwissenschaftler Maarten Vink, zitiert vom Soziologen Hein de Haas, Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt schwächen.
Was die Forschung sagt
Viele Integrationspolitiken zeigen nur eine geringe Wirkung. Die Staatsbürgerschaft ist hier eine wichtige Ausnahme: Je aussichtsreicher der Weg zur Staatsbürgerschaft ist, desto sicherer sehen Migrant*innen ihre Zukunft und desto stärker investieren sie in Bildung, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe. Das zeigt sich auch daran, dass insbesondere in den Jahren vor der Einbürgerung die höchsten Einkommenszuwächse zu verzeichnen sind.
Die Staatsbürgerschaft stärkt die Identifikation mit dem neuen Land. Diese Identifikation fördert ökonomische Integration und damit auch gesellschaftliche Teilhabe.
De Haas fasst das wie folgt zusammen: „Solange der Staat die [Migrant*innen] arbeiten lässt, ihre Rechte schützt und Wege zum dauerhaften Aufenthalt und zur Staatsbürgerschaft aufzeigt, integrieren sie sich ganz von selbst“.
Werden Menschen hingegen über Jahre in rechtlicher Unsicherheit gehalten, führt das zu wachsender sozialer und ökonomischer Ungleichheit – und genau diese Ungleichheit ist, so de Haas, ein zentraler Treiber von Spaltung, Gewalt und Kriminalität.
Wie die Regierung gegen die „Turboeinbürgerung“ argumentiert und warum das wissenschaftlich nicht haltbar ist
In ihrem Änderungsentwurf zum bestehenden Gesetz schreiben CDU und CSU: „Eine nachhaltige Integration in die hiesigen Lebensverhältnisse benötigt Zeit.“ Nach de Haas ist das nicht ganz richtig: Diese Annahme verkennt, dass sowohl eine Perspektive als auch eine Zugehörigkeit entscheidende Treiber von Integration sind – nicht Wartezeit.
CSU-Minister Dobrindt erkennt den bedeutenden Faktor der Einbürgerung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zwar an, für ihn müsse diese jedoch als Anerkennung am Ende eines Integrationsprozesses stehen – „nicht als Anreiz für illegale Migration“. Damit verkennt er nicht nur den Anreiz der Staatsbürgerschaft für Integration, sondern bedient das wissenschaftlich breit kritisierte Push-und-Pull-Modell, wonach großzügige Einwanderungsregeln Migration angeblich anzögen.
Die Faktoren, die Migrationsprozesse lenken, sind zu Komplex und Vielfältig um sie allein auf Entscheidungen im Einwanderungsland zurückzuführen. Insbesondere weil vor allem soziale Netzwerke und die Arbeitsmarkt Situation – sowohl im Herkunfts- als auch Einwanderungsland – in Migrationsentscheidungen einfließen. Die Aussagen der CDU schüren daher vor allem Misstrauen. Denn der Fachkräftemangel – unter anderem ein Grund für die Einführung der Staatsbürgerschaft nach drei Jahren – ist in aller Munde.
Dobrindt lenkt die Thematik auf einen wettbewerbsfähigen Mittelstand und attraktive Arbeitsplätze, um Fachkräfte anzuwerben. Das mag in Teilen stimmen, doch wer hier lebt, sich in die Gesellschaft einbringt oder arbeitet und Steuern zahlt, sollte eben auch politisch mitbestimmen dürfen. Die aktuelle Entwicklung vermittelt: Trotz aller Anstrengung „gehört ihr nicht dazu“. Das führt zu Vertrauensverlust – und irgendwann vielleicht auch zum Verlust des Interesses, zu bleiben.
Zusammengefasst: Was durch die Abschaffung der „Turboeinbürgerung“ verloren geht
Die Einbürgerung nach drei Jahren war ein ehrliches Signal der Aufnahmebereitschaft seitens der Politik, das zu einem wichtigen und eigentlich schon verspäteten Zeitpunkt kam. Deutschlands Beliebtheit als Einwanderungsland nimmt massiv ab (an anderer Stelle einmal mehr darüber, was das Abwerben von Arbeitskräften eigentlich für die abgebenden Länder bedeutet – Stichwort: Neokolonialismus). Für den Moment war die Einbürgerung nach drei Jahren in einem mehr als toxischen Migrationsdiskurs aber ein kleines Symbol, das gezeigt hat: „Wir wollen euch als Teil dieser Gesellschaft.“
Ihre Abschaffung und die Rückkehr zur Fünf-Jahres-Frist mag auf den ersten Blick moderat wirken. Doch im Zusammenspiel mit Grenzkontrollen und dem Aussetzen des Familiennachzugs sendet die Regierung das entgegengesetzte Signal: Es zeigt den Menschen: Ihr gehört (noch) nicht richtig dazu. Das schwächt das Zugehörigkeitsgefühl, fördert Misstrauen, bremst Integrationsfortschritte und führt letztendlich zu gesellschaftlicher Spaltung.
Was die Abschaffung über die Debatte in Deutschland zeigt
Die Diskussion über Migration und Integration wird in Deutschland häufig auf eine rein wirtschaftlich-technische Ebene reduziert: Fachkräfte hier, Sozialleistungen da. Doch Migration ist weit mehr als ein arbeitsmarktpolitisches Thema – es geht um gesellschaftlichen Zusammenhalt, demokratische Teilhabe, Gerechtigkeit und Menschenwürde.
Auch dieser Beitrag kann die Komplexität der Debatte nur anreißen. Er ist ein Versuch, die Diskussion um Einbürgerung und Integration stärker in den Kontext wissenschaftlicher Erkenntnisse und sozialer Realität zu rücken. Denn wenn Politik dauerhaft gegen Forschung, Fakten und die Lebenswirklichkeit der Menschen entscheidet, verspielt sie Vertrauen – und damit genau das, was sie zu schützen vorgibt: den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Zu dem Migrationsdiskurs haben wir auch hier und hier gearbeitet.
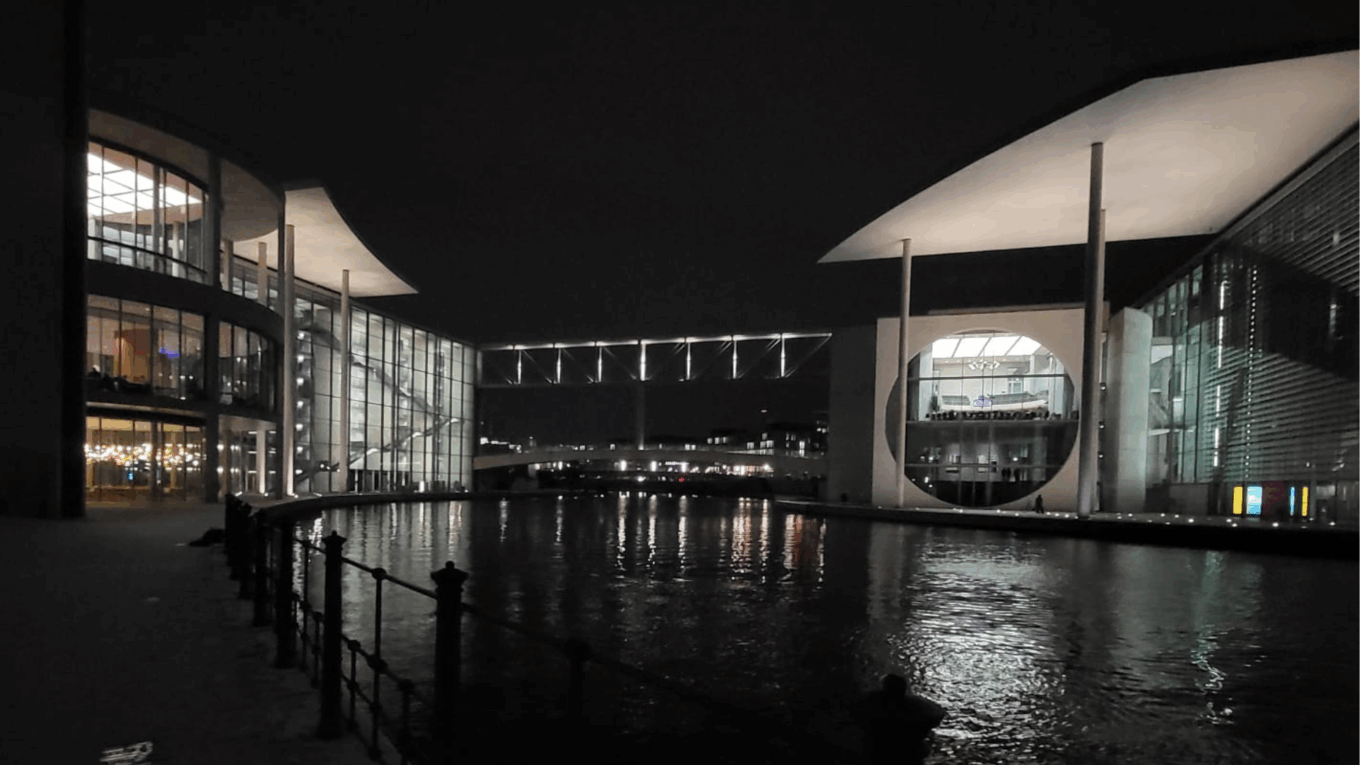



Nun geht es €DU/€SU aber nicht um Wissenschaftlichkeit sondern bloß darum, „am rechten Rand“ keine Stimmen zu verlieren. Sicher: Dumm, peinlich, einem Staatswohl nicht dienlich, aber aus rein wahltaktischen Gründen leider nachvollziehbar. 🙁